Am 28. September 2025 stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über das neue Bundesgesetz zur Einführung eines staatlichen elektronischen Identitätsnachweises (E-ID) ab. Die E-ID soll Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich im Internet sicher und eindeutig auszuweisen und damit digitale Behördengänge sowie Online-Dienstleistungen zu erleichtern.
Nachdem die privat betriebene E-ID im Jahr 2021 an der Urne scheiterte, erarbeitete der BundesratDer Bundesrat der Schweiz bildet die Exekutive bzw. Regierun... einen neuen Vorschlag. Dieser wurde im November 2023 dem ParlamentDas Parlament ist in demokratischen Verfassungsstaaten die V... vorgelegt und daraufhin angenommen. Weil im Frühling 2025 gegen den Parlamentsentscheid das ReferendumUnter einem Referendum versteht man die Volksabstimmung übe... ergriffen wurde, kommt das Gesetz nun vor das Stimmvolk. Da es sich um ein fakultatives ReferendumUnterliegt ein Beschluss des [[Parlament|Parlamentes]] dem f... handelt, braucht es für die Annahme lediglich das Volksmehr, nicht aber ein Ständemehr.
Ausgangslage
In der Schweiz gibt es bislang keinen staatlich herausgegebenen digitalen Identitätsnachweis. Wer sich im Internet sicher und offiziell ausweisen möchte, etwa für Behördengänge, Vertragsabschlüsse oder Online-Bestellungen, verfügt heute über keine einheitliche Lösung. 2021 lehnte 64.4% des Stimmvolkes eine erste Vorlage ab, weil die Herausgabe der E-ID privaten Unternehmen überlassen worden wäre und Bedenken bezüglich Datenschutzes und Sicherheit bestanden.
Mit dem neuen E-ID-Gesetz übernimmt der Bund die Verantwortung für Ausstellung, Betrieb und Sicherheit des elektronischen Identitätsnachweises. Die Nutzung soll freiwillig und kostenlos sein. Die persönlichen Daten werden dezentral direkt auf dem Smartphone der Nutzerinnen und Nutzer gespeichert. Ziel ist es, die digitale Transformation der Schweiz voranzubringen und den Zugang zu digitalen Dienstleistungen zu erleichtern.
Argumente der BefürworterInnen
Die BefürworterInnen betonen, dass die E-ID freiwillig, sicher und staatlich betrieben sein würde. Persönliche Daten würden dezentral auf dem eigenen Gerät gespeichert werden, was den Schutz der Privatsphäre stärken würde. Zudem erleichtere die E-ID Behördengänge und spare Zeit, besonders für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Auslandsschweizerinnen und Auslandschweizer.
Auch für die Wirtschaft werden Vorteile erwartet. Ein staatlicher digitaler Identitätsnachweis schaffe eine moderne Infrastruktur, fördere Innovation und stärke die Wettbewerbsfähigkeit. Für private Anwendungen wie Online-Verträge oder sichere digitale Kommunikation biete die E-ID neue Möglichkeiten und treibe die digitale Transformation der Schweiz voran.
Argumente der GegnerInnen
Die GegnerInnen sehen in der E-ID vor allem Risiken in Zusammenhang mit Datenschutz, Privatsphäre und der gesetzlichen Verankerung der Freiwilligkeit. Sie befürchten, dass persönliche Daten missbraucht oder für Profilbildungen und gezielte Werbung genutzt werden könnten. Zudem wird kritisiert, dass die Technologie noch nicht ausgereift genug und anfällig für Cyberangriffe sei.
Darüber hinaus warnen KritikerInnen vor einer möglichen indirekten Diskriminierung, wären bestimmte Dienstleistungen künftig nur noch online zugänglich. Generell sei die E-ID unnötig, weil heute schon digitale Behördengänge durch das System AGOV sichergestellt seien. Langfristig warnen sie vor einer möglichen Entwicklung hin zu staatlicher Überwachung.
Internationaler Vergleich
In Ländern wie Estland oder Österreich ist die E-ID bereits fest im Alltag verankert und für viele Vorgänge verpflichtend. Die Schweiz setzt dagegen auf eine freiwillige Nutzung, was den Einstieg erleichtert, die Verbreitung jedoch langsamer machen könnte. In der EU wird der digitale Identitätsnachweis zunehmend grenzüberschreitend eingesetzt, während die Schweizer E-ID rechtlich unabhängig bleiben und für internationale Anwendungen eigene Abkommen benötigen würde. Damit verfolgt die Schweiz einen Mittelweg: staatlich kontrolliert, freiwillig, und vorerst auf nationale Zwecke beschränkt.
Literaturverzeichnis
-
Allianz pro e-ID. (2025, 19. August). Staatlich, sicher und freiwillig: Breite Allianz steht hinter der neuen e-ID. Abgerufen am 9. September 2025, von https://www.ja-zur-eid.ch/de/news/staatlich-sicher-und-freiwillig-breite-allianz-steht-hinter-der-neuen-e-id
-
Allianz pro e-ID. (o. D.). Ja zur E-ID. Abgerufen am 29. August 2025, von https://www.ja-zur-eid.ch
-
Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden AGOV. (2025, 8. Juli). Fragen & Antworten. Abgerufen am 9. September 2025, von https://www.agov.admin.ch/de/fragen-und-antworten
-
Bundesamt für Justiz BJ. (2025, 20. Juni). Staatliche E-ID. Abgerufen am 29. August 2025, von https://www.metas.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/staatliche-e-id.html
-
BundeskanzleiDie Bundeskanzlei ist die Stabsstelle des Bundesrats. Mit ih... BK. (2021, 1. September). Volksabstimmung vom 07.03.2021. Abgerufen am 9. September 2025, von https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20210307/index.html
-
Der BundesratDer Bundesrat der Schweiz bildet die Exekutive bzw. Regierun... (2025, 30. Mai). Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz). Abgerufen am 29. August 2025, von https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210307/bundesgesetz-uber-elektronische-identifizierungsdienste.html
-
Der BundesratDer Bundesrat der Schweiz bildet die Exekutive bzw. Regierun... (2025, 29. August). E-ID Gesetz. Abgerufen am 30. August 2025, von https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20250928/e-id-gesetz.html
-
Digitale Integrität Schweiz. (o. D.). Steilpass an Big Tech – E-ID-Gesetz NEIN am 28. September. Abgerufen am 30. August 2025, von https://e-id-gesetz-nein.ch
-
Digitale Verwaltung Schweiz. (o. D.). Studien. Abgerufen am 30. August 2025, von https://www.digitale-verwaltung-schweiz.ch/publikationen/studien
-
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG. (2025, 12. August). Abstimmung über die E-ID: BundesratDer Bundesrat der Schweiz bildet die Exekutive bzw. Regierun... empfiehlt ein Ja [Medienmitteilung]. Abgerufen am 28 August 2025, von https://www.ebg.admin.ch/de/newnsb/ufuKN-DLE-hSGFj9etCeM
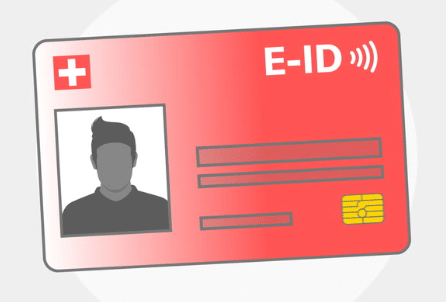




Personen haben auf diesen Beitrag kommentiert.
Kommentare anzeigen Hide commentsNEIN zum E-ID-Gesetz: Datenschutz-Defizite, fehlende Freiwilligkeit
Das Gesetz bietet keine sicheren Datenschutz-Standards. Unternehmen könnten mittels der E-ID beliebig Daten sammeln, verknüpfen, analysieren und daraus Verhaltensprofile der Bürger:innen anfertigen. Diese Daten können für Werbezwecke oder politische Beeinflussung benutzt werden. Ebenso befolgt die E-ID den Grundsatz der Transparenz nicht, denn entscheidende Teile der aktuellen Technologie werden geheim gehalten. Das E-ID-Gesetz befördert auch die missbräuchliche Nutzung von sensiblen Personendaten und schützt nur ungenügend gegen die zunehmende Zahl von Cyberangriffen.
Im Gesetz fehlt der Grundsatz, dass ein elektronischer Identitätsnachweis gänzlich freiwillig bleiben wird. Die drohenden Extrakosten für Dienstleistungen ohne E-ID drängen die Bevölkerung zur Nutzung. Menschen mit wenig Geld, ältere Personen oder andere Gruppen, die eine Nutzung nicht wollen oder sich nicht leisten können, werden benachteiligt. Es gibt schliesslich auch ein «Grundrecht auf digitale Integrität», ein Recht auf ein Offline-Leben. Menschen, die sich der ausartenden Digitalisierung des Alltags nicht unterwerfen wollen, dürfen nicht benachteiligt werden.