Hier nochmals ein Hinweis auf eine einflussreiche Frau der Schweizer Geschichte, auf eine Äbtissin. Katharina von Zimmern, geboren 1478 in Messkirch (im heutigen Baden-Württemberg), entstammte einer gebildeten süddeutschen Freiherrenfamilie. Als sie zehn Jahre alt war, fiel ihr Vater durch Intrigen bei Kaiser Friedrich III. in Ungnade; er wurde geächtet. Die Familie floh nach Weesen, das damals im Einflussbereich der Glarner lag. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sah Katharina dort den 6-jährigen Ulrich Zwingli, der bei seinem Onkel, dem Ortspfarrer, in Obhut gegeben worden war.
Der Vater brachte die beiden Töchter 1491 in die Fraumünsterabtei in Zürich, welche adeligen Frauen vorbehalten war. 1494 bekamen sie das Ordensgewand. Nach Hinweisen, dass in der Abtei sittlich bedenkliche Zustände herrschten und die beiden blutjungen Nonnen von Geistlichen belästigt würden, holte der Vater die beiden Töchter für kurze Zeit nach Weesen zurück. (Die Abtei umfasste auch einen Männerkonvent für die Chorherren …) Das Fraumünster galt formell als Benediktinerinnenkloster; die adeligen Frauen lebten dort jedoch wie in einem freien Stift. Bereits 1496 – mit 18 Jahren! – wurde Katharina zur Fürstäbtissin gewählt. Damit gehörte die Klerikerin zum höchsten Adel im HRR. Sie stand in der Gunst des Königs Maximilian I.
Katharina stand einem riesigen Klosterbetrieb mit weitreichenden Ländereien und vielen Untertanen von Süddeutschland bis in die Innerschweiz hinein vor. Sie hatte das Recht, allein für das Stift zu handeln, so auch Güter zu kaufen und zu verkaufen. Ausserdem war sie als Fürstäbtissin auch Stadtherrin von Zürich. Hohe Gäste Zürichs wurden von ihr begrüsst. Bei ihr lagen das Begnadigungsrecht und das Münzrecht der Stadt Zürich und das Recht, den Schultheissen zu ernennen.
Katharina von Zimmern sanierte die Finanzen der Abtei und entfaltete eine rege Bautätigkeit. Für die Ausmalung der Dreikönigskapelle engagierte sie berühmte Künstler. Sie veranlasste den Neubau des Abteigebäudes, das bis 1898 bestand. Heute würde man sie auch als Kunstmäzenin bezeichnen. Zur Abtei gehörte auch eine Schule, die unter Katharina neu gebaut wurde.
Während ihrer 28-jährigen Amtszeit als Fürstäbtissin wurde Katharina von Zimmern in den Ratsakten der Stadt nur ganz selten genannt, da ihre Amtsführung zu keinen Klagen Anlass gab. Im Unterschied zu ihren Vorgängerinnen erledigte sie ihre Aufgaben gewissenhaft und mit Takt und Diskretion.
In der Abtei lebten damals nur noch drei Stiftsdamen sowie sieben Chorherren. Bis 1503 traten vier junge Frauen in den Konvent ein. Damit erhöhte sich die Anzahl Stiftsdamen auf sieben. Später wird auch eine junge Stiftsdame erwähnt, welche mit grosser Sicherheit die uneheliche Tochter der Fürstäbtissin und des Freiherrn von Reischach war.
Als Frau von Bildung und Ansehen dürfte die Äbtissin Katharina von Zimmern die theologischen Diskussionen ihrer Zeit aus nächster Nähe erlebt haben. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen wählte sie 1496 mit Heinrich Engelhard einen späteren Parteigänger Ulrich Zwinglis zum Leutpriester im Fraumünster. (Fürstäbtissinnen durften Priester ernennen, aber keine priesterlichen Handlungen vornehmen!) Zwingli überreichte Katharina seine 1523 erschienene Reformationsschrift mit einer persönlichen Widmung.
Katharina von Zimmern förderte die Reformation in Zürich signifikant, indem sie 1524 das Fraumünsterstift der Stadt übergab – ohne Bedingungen. Sie erhielt dafür für sich eine hohe Leibrente, ein lebenslanges Wohnrecht im Äbtissinnenhaus und das Bürgerrecht. Katharina verhinderte durch diese Übergabe einen drohenden Bürgerkrieg: Sie löste die Säkularisation der Klöster aus und ermöglichte so die Stabilisierung der Zürcher Reformation.
Ein weiteres Mal bewies Katharina ihre Eigenständigkeit und heiratete kurz darauf ausgerechnet den Freiherrn Eberhard von Reischach, der um 1516/18 von Zürich wegen der Anwerbung von Söldnern für den Herzog von Württemberg in Abwesenheit zum Tod verurteilt worden war. Damit begann ihr neues Leben als Ehefrau eines geächteten Söldnerhauptmanns. Obwohl sie bereits 47 Jahre alt war, und ihr Mann 61, bekamen sie noch zwei weitere Kinder. Da Reischach auf Zürcher Boden sein Leben riskierte, lebte die Familie Reischach-Zimmern zunächst in Schaffhausen und in Diessenhofen, bis ihr 1529 eine Begnadigung die Rückkehr nach Zürich ermöglichte. Zwingli sicherte sich damit Reischachs Unterstützung in den drohenden militärischen Auseinandersetzungen mit den katholischen Orten. Beide fielen 1531 im Zweiten Kappelerkrieg.
Katharinas leibliche Schwestern waren ebenfalls sehr selbstständige Frauen: Auch sie heirateten selbstbestimmt: Im Spätmittelalter war noch ein blosses Eheversprechen gültig. Mit dieser Freiheit räumte dann die Reformation auf; selbstbestimmte Heiraten waren für die Frauen nicht mehr möglich.
Katharina von Reischach-von Zimmern starb 1547 in Zürich.
Mehr hier:
Christine Christ-von Wedel, Irene Gysel, Jeanne Pestalozzi und Marlis Stähli: Die Äbtissin, der Söldnerführer und ihre Töchter – Katharina von Zimmern im politischen Spannungsfeld der Reformationszeit, TVZ, 2019








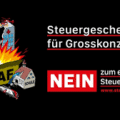











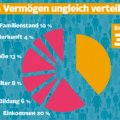


Keine Kommentare
Kommentar verfassen Cancel